
I.) Abb. _01
Face to [sur]face - Im Angesicht der Oberfläche
|
|
|
Die Leinwand an der Fassade ist ein Portrait der Begegnung Mensch – Maschine, eine face to surface Konstruktion, ein Architektur-Interface, aus der Sicht der Medien. Nur denken Architekten nicht medial - wir denken räumlich. An den Rändern streifen wir das Mediale vermittelt durch Oberflächen – Grenzen, die Raum konstituieren. Die medialen Möglichkeiten der Architektur sind bestimmt durch ihre Oberflächlichkeit und damit implizit räumliche Betrachtung.
|
|
Wie verhält sich Architektur zu Medium?
|
|
|
1.
Was man aner/kennt ist eine Architektur, die Medien als Funktion begreift, die Räume definiert als immersives X.) 9 Ambiente, in denen die Botschaft und das Medium für die Wahrnehmung untrennbar miteinander konvergieren. Das gilt für Las Vegas genauso wie für Disneyland, ein Opernhaus oder die Electronic Lounge [Abb. 01].
In der Welt der Medien hingegen ist "Architektur" ein gut eingeführter Begriff:
man spricht von "Chip Architektur", rühmt sich "Architects of the New Economy" oder betreibt "Interface Architecture" etc.
Und das scheinbar zu recht. Ist die Aufgabenstellung doch völlig analog: Für ein komplexes System von unanschaulichen Randbedingungen ist ein sprechender Anschein zu schaffen. Eine Fassade der Technik, deren eigenes Vokabular unzugänglich und unpopulär gilt.
Das Icon am Bildschirm repräsentiert weder die Funktion, noch die innere Logik der Maschine, die dieses Bild erzeugt. Es referenziert auf Ideen und Konzepte, vor jeder Maschine - zeitlich wie räumlich.
Dennoch teilen sich Graphiker überall die Überzeugung, daß die Formation der BildInformation eine empirische Frage sei. Nämlich systematisches Interface Design auf der Grundlage von Versuchsreihen und deren statistischer Auswertung. Gemeint ist - Usertesting für mainstream Websites.
Jakob Nielsen (als normative Instanz) gibt klare operative Anweisungen:
"Designing Web Usability" aus dem Jahr 1999 schafft die Kodifizierung des Netzes. Der Untertitel seines Bestsellers: The Practice of Simplicity fordert "die Anwendung des Einfachen".
Die Vorgangsweise ist entsprechend:
Eine Focusgruppe definiert das Problem: Welchen Zugang haben Menschen zu Inhalten? Man ordnet Themen bestimmten Kategorien zu, haufenweise. Die Auswertung dieser Häufungen etabliert eine Hierarchie und führt schließlich zu Prototypen informierter Oberflächen.
|
|
|
5 bis 15 User (wie empfohlen) werden der Oberfläche (Skin) ausgesetzt und ihr Verhalten registriert. Der Kauf eines Buches bei amazon.com benötigt im Test x Mausklicks. Die Anzahl der Klicks reduzieren, heißt schlicht den Umsatz erhöhen. "Users don't want to be entertained, they want to find something!" XIV.) 15 Goal directed behaviour als Vorraussetzung für wahrnehmungspsychologische Auseinandersetzungen.
Die Verwendung empirischer Techniken behauptet in erster Linie die Evaluierbarkeit, und in weiterer Folge, die Lenkbarkeit von menschlichem Verhalten. Die Frage nach der normativen Gültigkeit von Code bleibt dabei offen. Was bleibt ist desinging by pools - das Mehrheitsprinzip als Entwurfsmethode. Meinungsumfragen sondieren Konvention – erforschen Verbraucherverhalten. Implizit bedeutet das natürlich - Gutes Design ist akzeptiertes Design! Eine Haltung, die kommerzielle Gestaltung voraussetzt.
|
|
Ich stelle mir eine analoge Strategie in der Architektur so vor:
Eine zufällig ausgewählte Gruppe von Passanten entscheidet spontan, ob der Eingang eines Gebäudes gefunden werden kann oder nicht. Die Leser/Schreiber der Kronenzeitung verhindern den Bau eines Leseturms im Museumsquartier Wien IV.) 1, und Tierschützer argumentieren über die tödliche Wirkung von himmelb(l)auen Glasfassaden auf Zugvögel in Hainburg. V.) 2
2.
Mit der Reflexion der Architektur in den Medien streifen wir den zweiten Ansatz medialer Architektur, als Gegenstand vermittelter Realität.
Vitra, Guggenheim XIII.) 14 und als lokale Variante vor allem die 'G - City' im Gasometer beleben Schlagzeilen im Boulevard, Anekdoten im Feuilleton, und Fußnoten bei Architektursymposien. Diese Architekturen existieren durch und für die Berichterstattung - sind Kommunikations Ursache und Folge.
Das Prinzip der Talkshow VI.) 3 - etabliert den Meinungskonsens, und das täglich aufs Neue. Arch+, Schöner Wohnen, und Wallpaper* erläutern dem User was seine Zielgruppe zum Trend macht, affirmieren den aktuellen KursWert der Architektur.
Diese Wiederholung macht Sinn, ist - im Sinne Luhmanns - sinnkonstituierend. XI.) 10 XII.) 13
|
|
3.
Aber wie verhält es sich mit der Oberfläche, wenn Architektur selbst (Träger von) Information, selbst Vermittler von Bedeutung sein will? Wie soll sich diese Architektur verständigen?
Die Gegenwart der Vergangenheit hält dafür ein Repertoire von Zeichen und Symbolen bereit um deren "Selbstverständlichkeit" uns Mediendesigner beneiden.
Strassen, Plätze und Gebäude sind dem User in Form und Funktion völlig geläufig, das  Haus universell. Selbst Haus universell. Selbst  Windows bedarf keiner Erläuterung. Windows bedarf keiner Erläuterung.
Dennoch ist der Gebrauch von Icons und Ikonen (den Vorfahren der medialen Zeichen) in der Architektur prekär, wie folgendes Beispiel der Griechisch- Orthodoxen Kirche in Zürich zeigt: VII.) 4
Herzog & de Meuron konzipieren » einen Kirchenraum, der ausschließlich aus Ikonen bestehen soll […] dazu verwenden [sie] die photographischen Abbilder alter Ikonen […die sie] mittels Siebdruck auf […] Marmorplatten übertragen […] Aus diesen großflächigen, schwach lichtdurchlässigen […] Platten wird der ganze Kirchenraum, Wände und Decken aufgebaut. « VIII.) 5
Jacques Herzog zum Projekt im Herbst 2000: » The most beautiful building we ever would have built. « VII.) 4 Das Projekt scheitert am Oberhaupt der orthodoxen Kirche. Warum?
Die Ikone ist keine Abbildung der Realität, in unserem Fall der Präsenz Gottes, sie ist kein Gemälde, kein Bild und trotz ihrer (identischen) Vervielfältigung über Jahrhunderte und verschiedene Gemeinden hinweg ist sie nicht nur identisch mit der Präsenz des Heiligen - sie ist heilig. Der Zugang zu Gott ist für die Ortodoxie kein mediatisierter.
Mit der technischen Reproduktion - seit Benjamin Inbegriff des Medialen - setzt das Medium eine Rekonstruktion Gottes an die Stelle des "Originals".
Der orthodoxe Bischof hat das, so vermute ich, erkannt und daraus die Konsequenz gezogen. VII.) 6
Wahrheit, meint Hörisch, als [ihr] Ökonom, gibt es immer nur eine, und die ist grundsätzlich knapp. IX.) 7 - 8
Kritik an der inflationären Bilderflut ist der letzte Versuch den Wahrheitsgehalt durch ihre Verknappung zu erhöhen – erfolgLoos. Es gibt keine "wahre" Repräsentation in der Architektur. Die Unterscheidung Realität und Repräsentation ist zugunsten der Medialität aufgehoben. Mit dem Anspruch auf Wahrhaftigkeit fällt auch jede Scheu vor den Medien.
Mehr Renderings, mehr Animationen, mehr Photoshop, mehr Wallpaper*
|
|
|



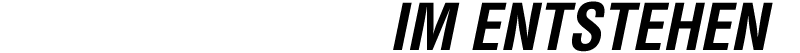






ZUM ANFANG
Soziale Netzwerke